Mercedes plant elektrische E-Klasse
Ob die elektrische E-Klasse den EQE ersetzen wird, verrät der Hersteller nicht, es ist aber anzunehmen. Denn schon bei der elektrischen G-Klasse wurde das Kürzel EQG vor dem Serienstart durch die Modellbezeichnung G 580 mit EQ-Technologie ersetzt. Und da sich der EQE nicht zum gewünschten Erfolgsmodell entwickelt hat, ist ein Neustart mit neuem Namen und neuer Technik wahrscheinlich.
Wie Mercedes-Benz in einer aktuellen Mitteilung schreibt, startet beginnend mit dem CLA in diesem Jahr eine umfassende Produktoffensive mit Dutzenden neuen oder überarbeiteten Modellen bis 2027. Mehr zum CLA, der zunächst elektrisch auf den Markt kommt und später auch als Mildhybrid angeboten wird, können Sie in unserem Deep Dive zur neuen MMA-Plattform nachlesen.
Schon bei jenem Tech Day im Werk Sindelfingen hatten die Entwickler betont, dass es sich bei der neuen Technik nicht mehr um starre Plattformen handelt, sondern einen flexiblen Ansatz. Komponenten wie die Elektromotoren (an der Hinterachse mit Zwei-Gang-Getriebe), Batteriemodule und Steuergeräte aus dem CLA können auch in größere Fahrzeuge übernommen werden, auch wenn diese streng genommen auf einer anderen Plattform basieren – wie etwa eine elektrische E-Klasse.
Einen großen Unterschied zum CLA wird es aber geben: Während der CLA als neues Einstiegsmodell bei Mercedes auf einer Plattform als Elektroauto und Verbrenner/Mildhybrid angeboten wird, werden laut Mercedes die „Fahrzeuge im Core- und Top-End-Fahrzeug (TEV)-Segment mit Hinterradantrieb auf separaten, kompromisslosen BEV/ICE-Konzepten“ basieren – „obwohl die Designs fast identisch sein werden“. Sprich: Beim CLA gibt es ein Fahrzeug mit unterschiedlichen Antrieben, ab dem Core-Segment (also der C-Klasse) sind die Elektro- und Verbrenner-Modelle genau genommen unterschiedliche Fahrzeuge auf eigenen Plattformen. Da sie aber „fast identisch“ aussehen sollen, dürften sie anders als bisher unter einem Namen vermarktet werden. „Mercedes-Benz wird ein stimmiges, statusorientiertes Design über das gesamte Portfolio hinweg anwenden, und die Kunden werden sich in erster Linie für ein Modell entscheiden – und dann ihren bevorzugten Antriebstyp wählen“, umschreibt Mercedes das Prinzip. Bisher mussten sich die Kunden im Falle des E-Klasse-Segments eben für die konventionelle E-Klasse oder den bewusst anders designten EQE entscheiden.
Diesen Ansatz hat Mercedes nach eigenen Angaben gewählt, damit die BEV- und Verbrenner-Modelle „ihre jeweiligen Stärken ausspielen, ohne Abstriche bei Platzangebot, Eleganz, Komfort oder Effizienz machen zu müssen“. Dank „intelligenter Modularisierung“ könne man „das beste Platzangebot und perfekte Proportionen“ bieten und gleichzeitig die Kostendisziplin und Fertigungsflexibilität beibehalten. Wie sich aber die jeweils unterschiedlichen Platzverhältnisse auf das Design auswirken werden, ist noch nicht bekannt.
Zur Produktoffensive gehören auch die Einführung eines neuen elektrischen GLC und die eingangs erwähnte neue vollelektrische E-Klasse. „Angetrieben durch die Einführung neuer BEV-Modelle“ strebt Mercedes-Benz für 2027 einen xEV-Anteil von mehr als 30 Prozent an. „Mercedes-Benz ist eine ikonische Marke. Unsere Verantwortung besteht darin, ihr volles Potenzial zu heben“, sagt Mercedes-CEO Ola Källenius. „Wir starten dazu die bisher größte Produkt- und Technologieoffensive unserer Unternehmensgeschichte und ein umfassendes Programm zur Steigerung unserer Leistungsfähigkeit.“
Mercedes ist mit dem Luxus-Kurs von Källenius inzwischen wirtschaftlich unter Druck geraten. Das Betriebsergebnis für 2024 fiel um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 13,6 Milliarden Euro, der Umsatz ging um 4,5 Prozent auf 145,5 Milliarden Euro zurück. In der wichtigen Pkw-Sparte sank die Margen von 12,6 auf nur noch 8,1 Prozent. Und auch im laufenden Jahr sollen Absatz und Umsatz erneut zurückgehen, so Mercedes bei der Bilanzvorlage. Daher will Mercedes nicht nur mit der angekündigten Modelloffensive bis 2027 gegensteuern, sondern auch mit Maßnahmen in der Produktion: Es sollen zwar keine deutschen Werke geschlossen werden, ihre Produktion wird aber auf jeweils 300.000 Fahrzeuge gedeckelt. Stattdessen soll mehr in Ländern mit niedriger Lohnstrukutur gebaut werden – der Anteil soll von heute 15 auf 30 Prozent bis 2027 steigen. Gemeint ist etwa die Produktion in Ungarn, da die Kosten im Werk Kecskemét um 70 Prozent geringer seien als in Deutschland.


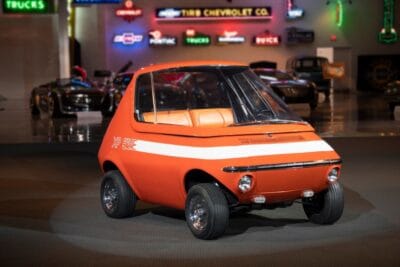


1 Kommentar