SeNSE-Projekt: Bessere Batterien dank Industrie-naher Entwicklung
In dem 2020 initiierten EU-Projekt unter Leitung der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) engagierten sich elf Teams aus Forschung und Industrie in Teilprojekten, um Batterien für Elektroautos maßgeblich zu verbessern. Dabei befassten sich die Teilnehmer mit annähernd der gesamten Wertschöpfungskette der Batterieherstellung: von der Entwicklung neuer Materialien, über deren Skalierung bis hin zum Einbau in Batteriezellen.
Zusammengeführt haben die Teilnehmer ihre Ergebnisse im sogenannten „SeNSE“-Modul, das laut Empa einige Verbesserungen gegenüber heutigen Akkus aufweist – etwa „eine höhere Energiedichte und eine günstigere Umweltbilanz, Schnellladefähigkeit, erhöhte Brandsicherheit und Wirtschaftlichkeit“. Als Prämisse galt dabei eine marktnahe, pragmatische Entwicklung, um die Batterie-Performance kurzfristig zu verbessern. „Wir forschen auch an Batterietechnologien, die potenziell um Welten besser sind als Lithium-Ionen-Akkus – nachhaltiger, sicherer, mit höherer Energiedichte“, sagt Corsin Battaglia, Leiter des Empa-Labors „Materials for Energy Conversion“ und einer der führenden Köpfe des SeNSE-Projekts. „Aber es dauert noch einige Jahre, bis sie industriell hergestellt werden können. In SeNSE wollten wir Technologien entwickeln, die innerhalb von wenigen Jahren in marktfertige Elektroautos verbaut werden können.“
SeNSE wurde von der EU mit 10 Millionen Euro unterstützt und zählte neben der Empa folgende Akteure zu den Teilnehmern: die Universität Münster, das Helmholtz-Institut Münster, die britische Coventry University, das AIT Austrian Institute of Technology und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) sowie aus der Industrie den schwedischen Batteriehersteller Northvolt, das Schweizer Innovationszentrum von FPT Industrial, die FPT Motorenforschung AG, die französischen Startups Solvionic und Enwires sowie den Chemiekonzern Huntsman mit Forschungsstandort in Basel.
Die Empa gibt an, dass „alle Kernkomponenten der Batterie“ im Projekt weiterentwickelt wurden. So enthalte die Kathode nur noch halb so viel Kobalt wie heutige Akkus und in der Anode sei ein Teil des Graphits durch Silizium ersetzt worden. Für den Elektrolyt entwickelten die Projektteilnehmer Zusätze, die die Brennbarkeit stark eindämmen, ohne die Leitfähigkeit zu beeinträchtigen. Und um die Schnellladefähigkeit weiter zu verbessern, entwickelte die britische Coventry University gemeinsam mit der FPT Motorenforschung AG ein ausgeklügeltes Temperaturmanagementsystem.
Als grössten Erfolg des Projekts nennt die Empa die Skalierbarkeit und den direkten Transfer in die Industrie. So konnten die beteiligten Industriefirmen für die SeNSE-Innovationen bereits mehrere Patente anmelden, Pilotanlagen bauen, Investorengelder einwerben und ihr erworbenes Wissen in weitere Batterietechnologien einfließen lassen. Dabei heben die Konsortialführer die Chemiefirma Huntsman hervor: Diese habe den Leitzusatz, der in den SeNSE-Elektroden zum Einsatz kam, sogar bereits auf den Markt gebracht, wo er nun Batterieherstellern zur Verfügung steht, teilen die Verantwortlichen mit.
Gänzlich gradlinig verliefen die vier Jahre Projektzeitraum unterdessen nicht: „Neben den großen organisatorischen Herausforderungen durch die Pandemie, die instabilen Lieferketten und die steigenden Rohstoff- und Energiepreise gab es auch technische Schwierigkeiten“, resümiert die Empa. So seien die Prototypzellen noch nicht so stabil, wie es das Projektteam gerne hätte. Auch die Skalierung, obschon erfolgreich, sei noch lange nicht abgeschlossen. „Wir haben alle Neuentwicklungen vom Labor- auf den Pilotmassstab skaliert“, äußert Battaglia. „Für die Produktion in einer sogenannten Gigafactory, z.B. unseres Projektpartners Northvolt […], müsste die ganze Materialherstellung noch einmal um den Faktor 1.000 hochskaliert werden.“ Dafür sei der Einsatz der Industrie gefragt.
Die Empa-Forschenden wenden sich derweil bereits dem nächsten europäischen Batterieprojekt zu. SeNSE hatte nämlich drei Schwesterprojekte und die Koordinatoren der aller vier Projekte haben inzwischen ein gemeinsames Forschungsprojekt namens IntelLiGent lanciert. Das Ziel: die Entwicklung von kobaltfreien Hochvoltzellen für Elektroautos.




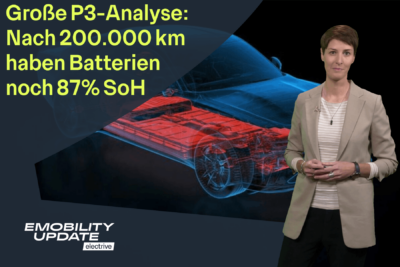
0 Kommentare