Wie die EU-Kommission die Autobranche bei der Antriebswende stützen will
+++ Dieser Artikel wurde aktualisiert +++
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch präsentiert, wie die Kommission die kriselnde europäische Autoindustrie unterstützen will. Das vorgestellte Papier verspricht etliche wichtige Impulse für die Branche in den kommenden Monaten und Jahren. Ausgearbeitet wurde der Plan im sogenannten Strategischen Dialog gemeinsam mit Vertretern der Autoindustrie. Wichtig: Noch handelt es sich nur um Vorschläge seitens der Kommission, denn die Maßnahmen des Aktionsplans müssen noch durch den regulären Gesetzgebungsprozess.
Starten wir inhaltlich: Wie die Kommission bereits am Montag vorab verkündet hat, plant Brüssel als einen der entscheidenden Punkte des Aktionsplans, das diesjährige CO2-Ziel für die Autohersteller abzuschwächen. Die OEMs bekommen konkret mehr Zeit: Sie sollen ihre CO2-Ziele nun in den kommenden drei Jahren erreichen dürfen – sofern wie gesagt das Parlament und die Mitgliedsstaaten zustimmen. Bereits im vergangenen Jahr waren Stimmen laut geworden, die CO2-Flottengrenzwerte abzuschwächen, um den unter wirtschaftlichem Druck stehenden Autobauern potenzielle Milliarden-Strafen bei Nichteinhaltung der Ziele zu ersparen. Eine Möglichkeit, die früh ins Spiel gebracht wurde: Das CO2-Ziel an sich bleibt bestehen, die Hersteller sollen aber mögliche Überschreitungen 2025 mit künftigen Unterschreitungen verrechnen können. Diesen Ansatz favorisiert nun also auch die Kommission. Sie schreibt wortwörtlich: „Die Änderung würde es den Automobilherstellern ermöglichen, eine Überschreitung der Zielvorgaben in einem oder zwei Jahren durch Übererfüllung in den anderen Jahren zu kompensieren.“
Unangetastet bleibt zunächst das Ziel, dass in der EU im Jahr 2035 de facto keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden sollen. Die offizielle Überprüfung dieses Gesetzes ist für 2026 vorgesehen. Die Kommission stellt aber in Aussicht, eine Überarbeitung dieser Verordnung zu „beschleunigen“. Das entsprechende Statement im Aktionsplan lautet wie folgt: „Das Klimaneutralitäts-Ziel 2035 für Autos schafft Vorhersehbarkeit für Investoren und Hersteller. Die Europäische Kommission wird die Arbeiten zur Vorbereitung der geplanten Überarbeitung der Verordnung beschleunigen.“ Diese Formulierung nährt die Ahnung, dass die Kommission zu Zugeständnissen bereit sein könnte, um das 2035er Ziel aufzuweichen.
Später am Tag kündigte EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas laut „Handelsblatt“ in der Tat an, das Gesetz zum Verbrenner-Aus früher überprüfen zu wollen als ursprünglich geplant. Und zwar bereits diesen Herbst.
Klar ist: Das Rückrudern bei den CO2-Flottengrenzwerten zeugt von einem Balanceakt, den die EU versucht: Die Autoindustrie stark fordern, aber nicht überfordern. Grundsätzlich spricht die Kommission von einem „entscheidenden Moment für die europäische Automobilindustrie – es muss entschieden gehandelt werden“. Als Schlüsselbereiche identifiziert haben die Verantwortlichen fünf Bereiche: 1) Innovation und Digitalisierung, 2) umweltfreundliche Mobilität, 3) Wettbewerbsfähigkeit und robuste Lieferkette, 4) Qualifikationen und soziale Dimension und 5) gleiche Wettbewerbsbedingungen und Business-Umfeld.
Großen Raum im Aktionsplan nimmt dabei die Elektromobilität ein. So will die Kommission die E-Auto-Förderungen der Mitgliedsstaaten vereinheitlichen und sie empfiehlt „Social-Leasing-Programme“ ebenso wie einen größeren Fokus auf Firmenflotten. Konkret kritisieren die Verantwortlichen, dass sich die Anreize nicht nur von Land zu Land unterscheiden, sondern auch häufig geändert werden, „was die Sicherheit für Verbraucher, Unternehmen und Investoren verringert“. Deshalb sollen Studien zur Wirksamkeit verschiedener Fördersysteme herangezogen werden, um die Ausgestaltung von Anreizsystemen zu optimieren. Und: „Ein besser koordinierter Ansatz auf europäischer Ebene ist erforderlich. Die Kommission wird unverzüglich damit beginnen, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um bewährte Verfahren und Erfahrungen mit Anreizsystemen für Verbraucher auszutauschen“, heißt es in dem Papier. Dabei werde ein Instrumentarium mit Optionen für Anreizsysteme entwickelt, die u.a. auf die Reife der betreffenden Märkte zugeschnitten sind. Und: „Es werden Möglichkeiten für mögliche Anreizsysteme auf EU-Ebene geprüft.“
Weiter empfiehlt die Kommission „Social-Leasing-Programme“, die einkommensschwache Haushalte durch vergünstigte Leasingangebote bei der Anschaffung von neuen oder gebrauchten E-Autos unterstützen. Dafür soll Geld aus dem Klimasozialfonds bereitgestellt werden. Und: Um den Anteil von E-Autos in Firmenflotten zu erhöhen, kündigt die EU einen separaten Gesetzesvorschlag an, der zurzeit ausgearbeitet wird.
Zum Themenfeld Ladeinfrastruktur bekräftigt die Kommission über die AFIR als Förderinstrument in diesem und im nächsten Jahr 570 Millionen Euro bereitstellen zu wollen, wobei der Schwerpunkt auf Infrastruktur für schwere Nutzfahrzeugen liegen soll. Außerdem sollen im noch für dieses Jahr geplanten Sustainable Transport Investment Plan zusätzliche Vorschläge enthalten sein, um „Hindernissen bei der Finanzierung der Ladeinfrastruktur zu beseitigen“. Weiterhin stellt die Kommission einen Leitfaden und Empfehlungen zur Verkürzung der Netzanschlussverfahren und zur Priorisierung entsprechender Netzanschlüsse in Aussicht. Ebenso Leitprinzipien für sogenannte vorausschauende Netzinvestitionen.
Für das dritte Quartal 2025 kündigt der Aktionsplan mit Blick auf den Straßengüterverkehr zudem eine European Clean Transport Corridor initiative an. Man wolle zusammen mit den Mitgliedstaaten an einer europäischen Initiative für saubere Verkehrskorridore arbeiten, allen voran entlang wichtiger
Logistikkorridore im TEN-V-Netz, so die Kommission. Neben dem Aufbau von Ladestationen für schwere Nutzfahrzeuge wollen die Partner dabei beispielsweise auch die Änderung von Flächennutzungsplänen anstoßen.
Grundsätzlich bekennt sich die Kommission zu einer beschleunigten Einführung von emissionsfreien schweren Nutzfahrzeugen. Dazu will sie u.a. eine Änderung der Eurovignetten-Richtlinie anpacken, um die Frist für die Befreiung der E-Lkw von Straßenbenutzungsgebühren über den 31. Dezember 2025 hinaus zu verlängern. Und auch die Novellierung der EU-Richtlinie zu Lkw-Gewichten und -Abmessungen soll „die Nutzlastparität mit Dieselfahrzeugen künftig sicherstellen“.
Die Batterien für die Fahrzeuge sollen dabei möglichst in der EU selbst hergestellt werden. Deshalb will die Kommission die Produktion von Batteriezellen mit drei Milliarden Euro fördern. Sie spricht von einem „Batterie-Booster-Paket“. In diesem Zuge soll auch „die direkte Produktionsförderung durch die EU gegenüber Unternehmen geprüft werden, die in der EU Batterien herstellen“. Diese EU-Unterstützung könnte mit staatlichen Beihilfen kombiniert werden. Zusätzlich zum bereits 2024 in Kraft getretenen Critical Raw Materials Act (CRMA) wollen die Verantwortlichen zudem „die Anforderungen an den europäischen Anteil von Batteriezellen und -komponenten in den in der EU verkauften E-Fahrzeugen in kommenden Gesetzen festlegen“.
Aus dem Aktionsplan geht ferner hervor, dass die EU-Kommission noch dieses Jahr eine Industrieallianz für vernetzte und autonome Fahrzeuge ins Leben rufen will, die gemeinsam Software, Chips und Technologien für das autonome Fahren entwickelt. Für diesen Bereich kann sich die Kommission auch eine IPCEI-Förderung vorstellen. Sie strebt konkret an, „eine kritische Masse von
Interessengruppen der europäischen Automobilindustrie zusammenzubringen, um die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration mit Schwerpunkt auf gemeinsamen Architekturelementen, gemeinsamen europäischen Hardware- und Software-Bausteinen sowie deren Normung zu unterstützen“. Kernprojekt soll die Entwicklung einer Software-Plattform für softwaredefinierte Fahrzeuge sein, um den Rückstand im globalen Wettbewerb – vor allem gegenüber China – aufzuholen.
Für Fortschritte beim autonomen Fahren strebt der Aktionsplan davon unabhängig die Einrichtung grenzüberschreitender Prüfstände für autonome Fahrzeuge ab 2026 an. Außerdem soll am Rechtsrahmen gefeilt werden, um harmonisierte Regeln für den Einsatz entsprechender Fahrzeuge in der gesamten EU zu erhalten.
Quelle: Infos per E-Mail, europa.eu




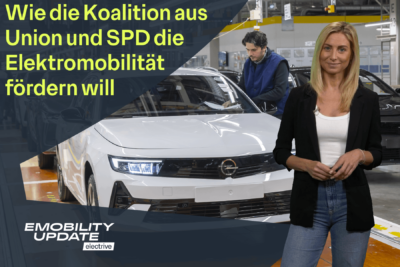
2 Kommentare