IDcycLIB-Projekt liefert Bausteine zu nachhaltigerer Batteriefertigung
Im IdcycLIB-Projekt befassten sich Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft seit 2021 mit der recycling- und umweltgerechten Herstellung von Elektroden sowie der anschließenden Rückgewinnung der Batteriematerialien über direktes Recycling. Dieser breite Ansatz spiegelt sich auch im Projektnamen „Innovationsplattform einer grünen, detektierbaren und direkt recycelbaren Lithium-Ionen-Batterie“ wider. Das vom Bundesforschungsministerium mit gut sieben Millionen Euro gefördert Projekt wurde unter Führung der Carl Padberg Zentrifugenbau GmbH (CEPA) von zehn Projektteilnehmern und zwei assoziierten Partnern getragen. Sie entwickelten u.a. fälschungssichere Marker, die Trenn- und Aufbereitungsprozesse vereinfachen und Materialströme digital erfassen. Und gingen im Recycling bei der wasserbasierten elektrohydraulischen Zerlegung und der Sortierung mit neuartiger Zentrifugentechnologie voran.
Doch der Reihe nach: Das Verbundforschungsprojekt setzte sich im Jahr 2021 fünf zentrale Arbeitsziele, die allesamt mit der Entwicklung eines nachhaltigen Batterie-Lebenszyklus zu tun haben:
- Grünere Lithium Batterien mit wasserbasierten Prozessen bei der Kathodenherstellung
- Design for Recycling, um später das Aufarbeiten von ausgemusterten Batterien zu erleichtern, z. B. leichteres Lösen von Siegelnähten
- Detektierbarkeit / Batteriepass – eindeutige Identifizierung durch magnetische und fluoreszierende Markerpartikel
- Wasserbasierte Recyclingprozesse – elektrohydraulische Zerkleinerung entlang der Materialgrenzen und neuartige Zentrifugentechnologien
- Life Cycle Assessment und Life Cycle Costing – Betrachtung des gesamten Herstellungs- und Lebenszyklus der Batterie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt, eingeschlossen eine digitale Plattform für die Umsetzung des geforderten Batteriepasses
Laut Projektkoordinator Felix Seiser von der Carl Padberg Zentrifugenbau GmbH wurde auf diese Weise „der komplette Wertschöpfungsprozess der Batterie und seine Verbesserungspotenziale hinsichtlich Umweltfreundlichkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit adressiert.“ Mit Blick auf die Kathodenherstellung ersetzen die Projektteilnehmer das als Binder-Material eingesetzte PVDF (Polyvinylidenfluorid) – ein Mitglied der zunehmend in die Kritik geratenen PFAS-Familie – durch einen Binder auf Cellulosebasis. Außerdem nutzten sie statt dem Lösemittel NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidon) Wasser, denn NMP gilt als reproduktionstoxisch.
Den auf diese Weise entwickelten wasserbasierten Prozess bezeichnen die Forscher als einen großen Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Batterieherstellung: „Wasser ist natürlich immer das Wunsch-Prozessmittel. Aber hier hatten wir mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass die üblichen Kathodenmaterialien und auch die Stromableiter aus Aluminium durch Wasser geschädigt wurden“, sagt Andreas Flegler, wissenschaftlicher Koordinator des Projekts am Fraunhofer ISC. Um das Aktivmaterial der Kathoden vor Schäden zu schützen, modifizierte das Team des Fraunhofer ISC deshalb die Oberfläche mit einer speziellen Beschichtung und teste dann die Skalierung zur Pilotproduktion. Der wasserbasierte Prozess sei in diesem Maßstab ein echtes Novum und bietet einen weiteren Vorteil, wie die Projektteilnehmer betonen: „Dank des wasserlöslichen Cellulose-Binders können wir auch beim späteren Recycling auf Wasser als Lösemittel zurückgreifen.“
Als weiteren Erfolg des Projekts werten die Partner die Fortschritte beim sogenannten Direct Recycling: Die Batteriezellen werden dabei laut den Verantwortlichen mit einem neuen Verfahren (der elektrohydraulischen Zerkleinerung, EHZ) entlang der Materialgrenzen sauber aufgespalten und lassen sich dann mit automatisierter und skalierter Zentrifugentechnologie von CEPA in die einzelnen Materialfraktionen trennen. „So können die Batteriematerialien funktionserhaltend zurückgewonnen und direkt für die Herstellung neuer Batteriezellen eingesetzt werden“, heißt es. Und: „Das direkte Recycling hat nicht nur hohes ökologisches Potenzial gegenüber dem Stand der Technik. Es ist auch bereits in unserem kleinen Projekt-Maßstab wirtschaftlicher als die herkömmlichen Prozesse wie Pyrometallurgie und Hydrometallurgie.“ Auf den Erkenntnissen dieses Teilprojekts baut inzwischen das 2024 gestartete Projekt REWIND auf.
Im Feld „Detektierbarkeit / Batteriepass“ hat das Projekt zudem Verfahren und Materialien hervorgebracht, die eine automatisierte und individualisierte Datenerfassung in der Zellproduktion sowie eine Übertragung in ein geeignetes Datenbanksystem möglich machen sollen. Kern des Ansatzes sind „fälschungssichere Markierungen“ in Form von speziell designten magnetischen Markerpartikeln im Kombination mit einer ausgeklügelten Detektionsmethodik. Selbst einzelne Komponenten wie Elektrodenmaterialien sollen dank der fluoreszierenden Markerpartikel eindeutig zuortbar sein.“ Das Projektteam bezeichnet die Methode als geeignet, um individuelle Pässe für einzelne Komponenten sowie für die Gesamtbatterie zu erstellen und dort alle relevanten Informationen über Produkteigenschaften, Zusammensetzung, kritische Rohstoffe, Rezyklierbarkeit, CO2-Fußabdruck und spezifische Messgrößen zu hinterlegen.
Teil des Konsortiums waren neben CEPA die Universität Erlangen-Nürnberg, die Fraunhofer‑Institute ISC und IIS, die Polysecure GmbH, Pure Devices GmbH, MAB Recycling GmbH, die iPoint-systems GmbH, die IFU Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH und die EurA AG. Als assoziierte Partner agierten BASF und Leclanche.




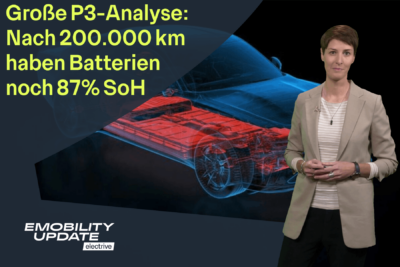
0 Kommentare