BDL Next zeigt Lösungsansätze für bidirektionales Laden
Elektroautos haben bekanntlich große Batterien – und diese könnten gut für die Energiewende genutzt werden, in dem sie den überschüssigen Strom aus dem öffentlichen Netz tagsüber speichern und in den Abend- und Nachtstunden wieder ins Netz einspeisen. Das nennt sich Vehicle to Grid (V2G) und ist eine wichtige Spielart des bidirektionalen Ladens.
Doch eine erfolgreiche Umsetzung von V2G in Deutschland scheitert aktuell daran, dass die Zwischenspeicherung von Strom aus dem Netz in E-Auto-Batterien unwirtschaftlich ist. Das liegt daran, dass gegenwärtig bezogener Netzstrom, welcher zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Stromnetz zurückgespeist wird (zwischengespeicherter Netzstrom), größtenteils mit der gleichen Menge an Stromnebenkosten wie Steuern, Abgaben, Umlagen (STAU) und Netzentgelten belastet wird, wie tatsächlich verbrauchter Netzstrom. Laut dem „BDL Next“-Projekt kommen dabei ca. 23 Cent pro Kilowattstunde an Kosten zusammen. Ein gewinnbringender Verkauf dieser Kilowattstunde, z. B. mit mehr als 30 ct/kWh, wäre nur in weniger als 50 Stunden im Jahr möglich, z.B. wenn der Marktpreis für Strom sehr teuer ist.
Es gilt also, nach regulatorischen Lösungen zu suchen, die V2G deutlich günstiger und damit attraktiver machen. Und genau das hat das BDL-Team vom Bayernwerk um Wolfgang Duschl nun getan und in einem Diskussionspapier genau die Hürden, die den Stromhandel noch unwirtschaftlich machen, identifiziert und Grundlagen herausgearbeitet, die diese Hürden aus dem Weg räumen könnten.
Das Diskussionspapier beschäftigt sich mit dem Dilemma, wie sich zwischengespeicherter Netzstrom rechtlich, technisch und wirtschaftlich so erfassen lässt, dass er fair behandelt wird. Denn die Batterien von Elektroautos könnten helfen, Lastspitzen im Netz zu glätten, erneuerbare Energien besser zu integrieren und regionale Engpässe zu entschärfen – also genau das tun, was das Netz in Zukunft dringend braucht.
Neuess Mess- und Zählerkonzept
Kern des Papiers ist die Forderung nach einem neuen Mess- und Zählerkonzept. Denn nur wenn genau erfasst werden kann, wann und wie viel Strom zwischengespeichert wurde, lässt dieser sich rechtssicher abrechnen – und die Grundlage für mögliche Kostenreduktionen bei Steuern und Netzentgelten schaffen. Das Bayernwerk-Team schlägt in dem Diskussionspapier ein minimalinvasives 2-Zähler-System vor: ein Zähler am Hausanschluss, ein weiterer für den Speicher bzw. die bidirektionale Wallbox. Ergänzt durch ein intelligentes Messsystem mit 15-Minuten-Intervallen, lässt sich damit exakt bestimmen, welcher Strom aus dem Netz kam, welcher aus der PV-Anlage – und wann wieder eingespeist wurde.
Ein zusätzliches Problem ergibt sich jedoch durch die Mobilität der E-Autos. Ein Fahrzeug kann an Ort A geladen, aber an Ort B entladen werden. Der Strommix ist dadurch kaum nachvollziehbar. War es grüner Strom von der Schnellladestation oder doch der graue Mix vom Arbeitgeber? Bisher ist laut Gesetz jeder Ladepunkt ein „Letztverbraucher“, unabhängig davon, wo das Auto steht. Die Batterie selbst bleibt rechtlich außen vor. Das macht die Regulierung kompliziert – und öffnet Tür und Tor für wirtschaftlich sinnlose Regelungen, die technische Innovation ausbremsen.
Regeln nicht auf Haushalte zugeschnitten
Die Bundesregierung hat mit dem § 21 EnFG bereits erste Weichen gestellt: Eine Umlagebefreiung für zwischengespeicherten Netzstrom ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Doch die Praxis zeigt: Diese Regelung ist auf Großspeicher zugeschnitten – nicht auf Haushalte. Die Voraussetzungen – wie etwa detaillierte 15-Minuten-Daten und aufwendige Anträge – machen eine Anwendung auf der Ebene von Einfamilienhäusern derzeit unwirtschaftlich. Und auch die Netzentgeltbefreiung nach § 118 EnWG gilt bisher nur für netzgekoppelte Speicher – nicht für mobile Batteriespeicher in privaten Fahrzeugen.
Was fehlt, ist ein integrierter, praxistauglicher Regelrahmen für Haushalte, der Kleinstflexibilitäten marktfähig macht. Ein zentrales Argument für in E-Auto-Batterien zwischengespeicherten Strom ist seine Netzdienlichkeit. Anlagen sind dann netzdienlich, wenn sie Netzkosten senken, etwa durch Engpassvermeidung oder Lastverschiebung. Bidirektionale Speicher könnten genau das leisten – wenn sie gezielt und intelligent eingesetzt werden.
Eine mögliche Lösung wäre ein Bonussystem: Wer Rückspeisung nur innerhalb definierter Leistungsgrenzen vornimmt – z. B. bei hoher Netzkapazität – könnte teilweise von Netzentgelten befreit werden. So entsteht ein Anreiz, das Netz zu entlasten statt zu belasten.
Ziel: Ein „Level Playing Field“
Die Autoren des Diskussionspapiers betonen: Die Technik für bidirektionales Laden ist da. Die Zähler sind verfügbar. Auch intelligente Messsysteme verbreiten sich zunehmend. Was jetzt fehlt, sind klare Regeln und ein einfacher Zugang zur Netznutzung für flexible Haushalte. Ziel ist ein „Level Playing Field“ – faire, einheitliche Bedingungen für Anbieter und Nutzer. Es geht um Schnittstellen, Datenformate, Abrechnungslogiken – aber auch um eine neue Sicht auf Energieverbrauch: dezentral, dynamisch, digital.
„BDL Next“ wurde im November 2023 vorgestellt und gehört in Deutschland zu den zentralen Forschungsprojekten zum bidirektionalen Laden und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit über elf Millionen Euro. Träger des Verbundprojekts ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Beteiligt sind u.a. Bayernwerk, BMW, Compleo und E.On. Nach drei Jahren Projektlaufzeit „sollen bidirektionale Serienfahrzeuge mithilfe standardisierter Technologien vollständig in energiewirtschaftliche Marktprozesse, den Netzbetrieb und das Energieökosystem der Kund:innen integrierbar sein“.

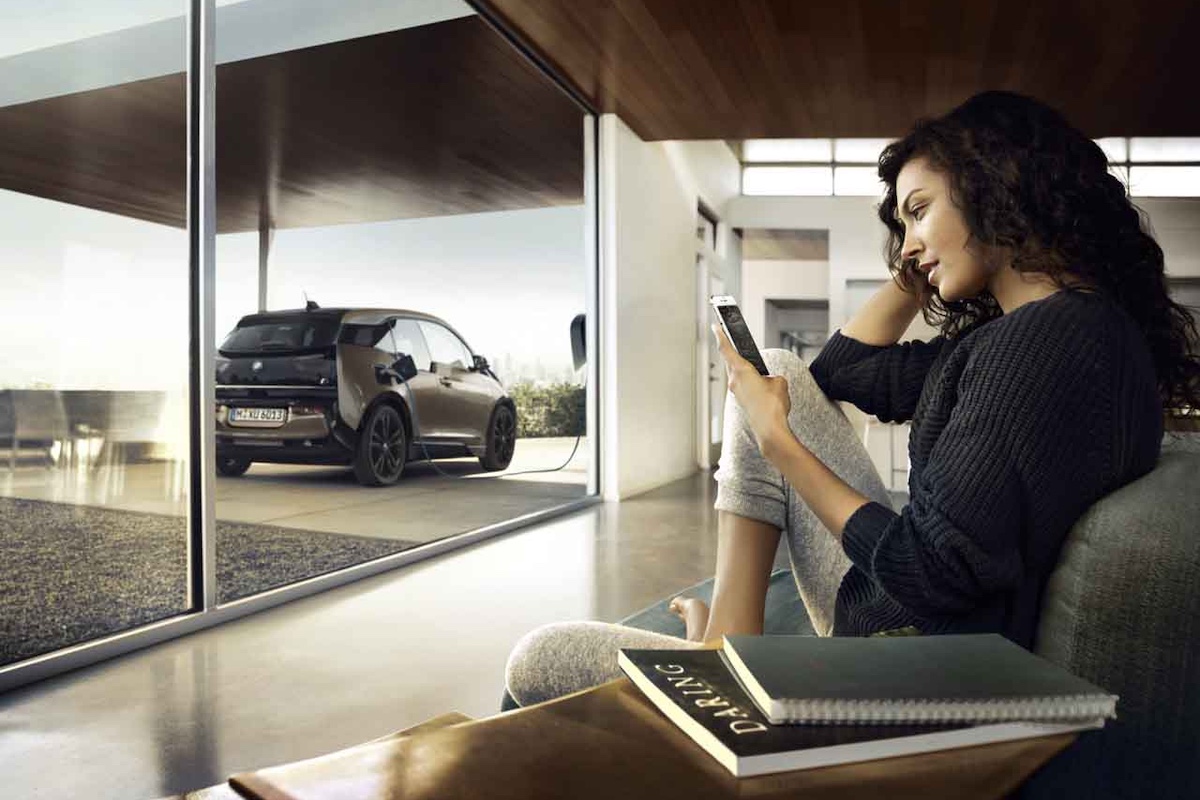



3 Kommentare